Am 2. April ist Weltautismustag. Ein Tag, der Sichtbarkeit schaffen, Aufklärung fördern und Verständnis für Autistinnen und Autisten wecken soll – das ist etwas, das hier auf Ellas Blog das gesamte Jahr über passiert.
Gleichzeitig findet vom 31. März bis 04. April 2025 eine bundesweite Aktionswoche statt, in der die unverzichtbare Rolle von Fachkräften in der Eingliederungshilfe und Sozialpsychiatrie im Mittelpunkt steht.
Diese beiden Aktionen greife ich dieses Mal gemeinsam auf.
Denn sie gehören zusammen. Mehr denn je.
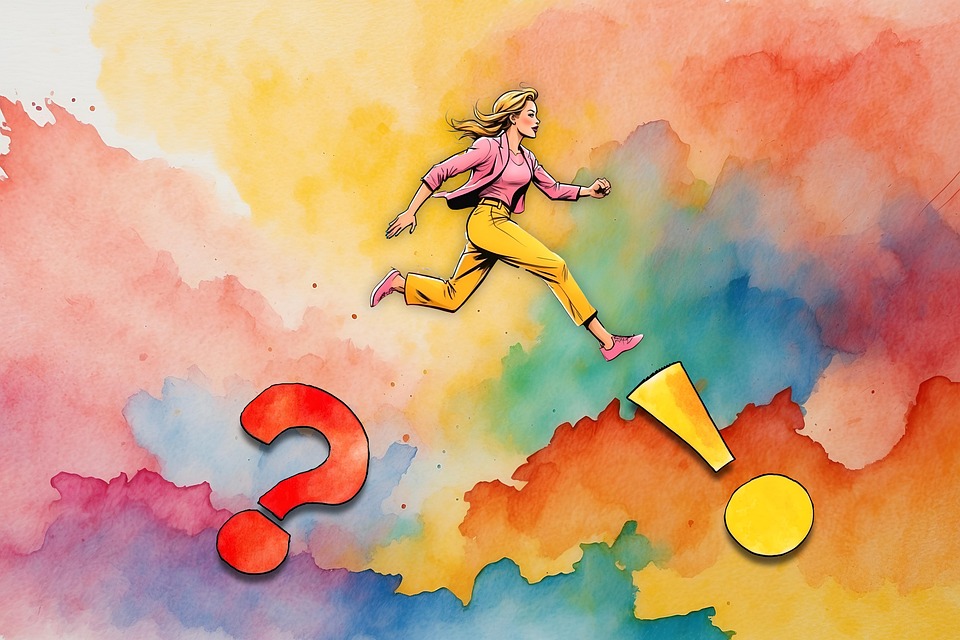
©Quelle: pixabay, User geralt, vielen Dank!
Zwischen Symbolkraft und Systemkrise
Am 2. April ist Weltautismustag. Ein Tag, der Sichtbarkeit schaffen und zum Nachdenken anregen soll. In den sozialen Medien wird gepostet, aufgeklärt, manchmal sogar gefeiert. Und das ist gut – jede Aufmerksamkeit zählt.
Gleichzeitig findet in diesem Jahr eine bundesweite Aktionswoche statt, in der die Rolle der Fachkräfte in der Eingliederungshilfe und Sozialpsychiatrie betont wird. Auch das ist wichtig. Denn ohne diese Menschen funktioniert nichts. Wirklich gar nichts.
Deshalb greife ich dieses Mal beides auf.
Ich selbst kläre seit vielen Jahren auf und und bin längst nicht die Einzige. Viele von euch, die hier lesen, tun das ebenfalls: schreiben, sprechen, begleiten, beraten, stehen ein. Nicht nur einmal im Jahr, sondern Woche für Woche. Und ja, punktuell bewegt sich auch etwas. Manchmal entstehen neue Projekte, es gibt offene Gespräche, echte Begegnungen und tolle Menschen, die für unsere Familien und unsere autistischen Angehörigen da sind.
Diese engagierten, empathischen Fachkräfte gibt es noch. Und sie machen einen Unterschied.
Aber es werden weniger. Nicht, weil sie weniger wollen, sondern weil es insgesamt immer weniger Mitarbeitende in diesen Bereichen gibt. Und besonders dort, wo es komplex wird, wo hohe Unterstützungs- und Pflegebedarfe auf besondere Bedürfnisse treffen, wird es richtig eng.
Die Lücken werden genau da größer, wo eigentlich mehr Menschen gebraucht würden, nicht weniger.
Wenn Aufklärung auf Personalmangel trifft
Wenn ich auf das große Ganze schaue, frage ich mich immer häufiger:
Warum stehen gerade die, die am meisten Unterstützung und Pflege brauchen, immer öfter ganz hinten in der Warteschlange oder gleich ganz draußen?
Während über Autismus in Teilbereichen immer mehr gesprochen wird, fehlen im Alltag die Menschen, die das Wissen in echte Unterstützung übersetzen können. Für viele Familien heißt das: es gibt keine Plätze mehr, weil niemand mehr da ist, der begleiten kann.
Anfragen bleiben unbeantwortet. Wartelisten werden zum Teil gar nicht erst geführt. Und selbst bestehende Unterstützungssettings brechen plötzlich weg, weil Mitarbeitende kündigen, ausfallen oder schlichtweg nicht ersetzt werden können.
Einrichtungen sagen: „Wir würden gerne, aber wir schaffen es nicht.“
Pflegedienste sagen: „Nicht bei diesem Unterstützungsbedarf.“
Die Familien bleiben mit ihren Angehörigen zurück.
Besonders schwierig ist das für Menschen mit komplexen Bedarfen: Wenn der Unterstützungsbedarf hoch ist, wenn Pflege dazu kommt, wenn Kommunikation nonverbal läuft oder herausforderndes Verhalten Teil des Alltags ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, noch irgendwo „unterzukommen“, besonders gering.
Das ist so, weil unser System „auf Kante genäht“ ist und weil genau dort das Personal fehlt, wo es am meisten gebraucht würde.
Denn was viele andere und auch ich erleben: Menschen mit komplexen Bedarfen bekommen immer seltener einen Platz. Nicht in der Tagesstruktur. Nicht in der Wohngruppe. Nicht in der Schule. Nicht in der Freizeitbegleitung. Und das trotz aller Aufklärung, trotz gesetzlicher Ansprüche, trotz Wunsch- und Wahlrecht.
Das ist die Realität, über die wir am Weltautismustag (auch) sprechen müssen.
Es liegt nicht an den Fachkräften, sondern am System
Bevor jemand denkt, ich würde hier mit dem Finger auf diejenigen zeigen, die tagtäglich versuchen, das alles irgendwie am Laufen zu halten: genau das Gegenteil ist der Fall. Ich habe in all den Jahren so viele Fachkräfte kennengelernt, die sich mit Herz, Verstand und großer Geduld einsetzen. Die kreative Lösungen finden, zuhören, stabilisieren, selbst dann, wenn ihre eigenen Ressourcen längst aufgebraucht sind.
Und ich weiß sehr genau, wovon ich spreche. Mein Sohn gehört zu der Klientel, die man heute leider viel zu oft als „schwierig vermittelbar“ bezeichnet: hoher Unterstützungs- und Pflegebedarf, nonverbal, herausforderndes Verhalten. Ohne die Fachkräfte und Mitarbeitenden, die ihn begleiten, unterstützen und wirklich sehen, wäre unser Alltag nicht möglich. Ich bin dafür jeden einzelnen Tag zutiefst dankbar.
Natürlich weiß ich auch: Nicht jede Erfahrung ist gut.
Es gibt Eltern, die viel zu oft mit Menschen zu tun haben, die unbelehrbar scheinen, nicht bereit sind, sich weiterzubilden oder auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. Es gibt Fachkräfte, die nicht (mehr) in diesen Beruf gehören, so wie es in jedem Bereich Menschen gibt, die ihre Arbeit nicht gut machen.
Das will ich gar nicht ausklammern. Im Gegenteil: Diese Erfahrungen gehören genauso zur Realität.
Aber es ist wichtig, den Blick auf das System zu richten und nicht pauschal Menschen verantwortlich zu machen, die in Strukturen arbeiten, die ihnen kaum Luft zum Atmen lassen.
Es mangelt in der Regel nicht an gutem Willen. Es mangelt an Zeit, an gesicherter Finanzierung, an verlässlichen Rahmenbedingungen, an Wissen um rechtliche Grundlagen, insbesondere auch das Bundesteilhabegesetz.
Und es mangelt an einer Arbeitsrealität, in der Menschen nicht ausbrennen, nur weil sie ihren Beruf ernst nehmen. Denn genau das passiert immer häufiger: Gute Fachkräfte verlassen das Feld nicht, weil sie es nicht mehr wollen, sondern weil sie nicht mehr können, weil sie dauerhaft an der Belastungsgrenze arbeiten, keine Pausen mehr möglich sind und weil die Anforderungen steigen, während die Unterstützung schrumpft.
Der Fachkräftemangel kommt nicht aus dem Nichts. Er ist das Ergebnis eines Systems, das soziale Arbeit seit Jahrzehnten unter Wert laufen lässt. Und besonders stark trifft es die Bereiche, in denen die Arbeit als „zu schwer“ gilt: Menschen mit hohem Unterstützungs- und Pflegebedarf oder sehr individuellen Bedürfnissen.
Gerade dort müssten die besten, erfahrensten Fachkräfte arbeiten, mit ausreichend Zeit, fairer Bezahlung und echtem Rückhalt. Doch genau dort sind die Stellen am schwersten zu besetzen.
Das ist ein strukturelles Versagen und macht es umso dringlicher, endlich politisch und gesellschaftlich gegenzusteuern.
Wer hilft, wenn niemand mehr da ist?
Wer hilft, wenn kein Mitarbeiter, keine Mitarbeiterin mehr kommt?
Wenn die Schulbegleitung ausfällt – wieder einmal.
Wenn der Pflegedienst absagt, weil keine Kapazitäten mehr da sind.
Wenn Einrichtungen Rückzug signalisieren, obwohl die Bedarfe steigen.
Dann bleibt am Ende oft nur noch eine Frage: Wer hilft jetzt eigentlich noch?
Für viele Familien ist das keine theoretische Überlegung, sondern Alltag. Sie stemmen Betreuung, Pflege, Krisenbegleitung, Organisation, Anträge, Gespräche, Netzwerkarbeit ohne Pause. Und das, obwohl Teilhabe gesetzlich verankert ist und obwohl die Rechte klar geregelt sind. Obwohl es eigentlich genug Stellen und Systeme geben sollte, die helfen könnten.
Aber was nützen dir Rechte, wenn es niemanden gibt, der sie umsetzt und sie stellenweise sogar gezielt unterlaufen werden?
Was bringt ein Schulplatz, wenn keine Begleitung gefunden wird?
Was soll ein individueller Hilfeplan bewirken, wenn das Personal fehlt, ihn mit Leben zu füllen?
Ich beobachte gleichzeitig, wie auf behördlicher und übergeordneter Ebene neue Webauftritte entstehen, weitere Broschüren entworfen und noch mehr Arbeitskreise ins Leben gerufen werden. Das ist gut gemeint und manches davon ist durchaus hilfreich. Aber während dort noch diskutiert, formuliert und strukturiert wird, passiert in der Lebensrealität vieler Familien – nichts.
Viel dringlicher wäre es, jetzt endlich ins Handeln zu kommen. Damit die Hilfen, die auf dem Papier existieren, auch wirklich bei den Menschen ankommen.
Diese Lücken führen nicht nur zu praktischen Problemen, sie wirken auch emotional tief. Wer über lange Zeit keinen Zugang zu Entlastung, zu echtem Verstehen und zu verlässlicher Unterstützung hat, läuft Gefahr, sich zurückzuziehen. Isolation entsteht nicht nur durch Barrieren im Außen, sondern auch durch ständiges Nicht-Gesehenwerden.
Und wenn Familien jahrelang im Daueranspannungsmodus leben, wenn sie alles kompensieren müssen, was eigentlich ein System leisten sollte, dann wächst die Überforderung schleichend bis sie kippt. Niemand kann das ab einem gewissen Level auf Dauer schaffen und ich bin regelmäßig zutiefst gerührt und bewegt, wenn mir Familien schreiben oder sich im Mitgliederbereich zu dieser Thematik öffnen.
Diese Realität muss Teil der Debatte sein – gerade am Weltautismustag.
Denn was nützt Sichtbarkeit, wenn diejenigen, die am dringendsten Unterstützung brauchen, genau dort durchs Raster fallen, wo es konkret wird?
Aufklärung alleine reicht nicht
Es wird viel über Autismus gesprochen, in diesen Tagen noch mehr als sonst. Das ist grundsätzlich gut. Sichtbarkeit schafft Verständnis, nimmt Ängste, öffnet Türen.
Aber: Wissen allein bringt noch keine Teilhabe.
Wenn wir am Weltautismustag über Vielfalt, Neurodivergenz und Akzeptanz sprechen, dann ist das wichtig, aber es darf nicht beim wohlmeinenden Teilen von Infografiken oder netten Statements stehen bleiben.
Denn die Realität vieler Familien sieht völlig anders aus. Sie brauchen keine weiteren theoretischen Erklärungen über Reizfilterschwächen oder Kommunikationsstile. Sie brauchen verlässliche Unterstützung, gute Begleitung und sichere Strukturen.
Wenn wir Aufklärung nicht mit konkretem Handeln verknüpfen, verpufft sie. Dann wird aus dem Weltautismustag ein jährlicher PR-Termin, der nett klingt, aber niemandem hilft, der nicht mehr weiter weiß, weil das System ihn im Stich lässt.
Ich wünsche mir, dass dieser Tag mehr ist als eine gut gemeinte Geste und dass er ein Anlass ist, ehrlich hinzusehen: Wo klemmt es? Wo passiert wirklich etwas? Wo wird viel geredet, aber wenig umgesetzt?
Akzeptanz und Inklusion müssen lebbar (also überhaupt möglich) gemacht werden: im Alltag, in der Schule, in Einrichtungen, bei Pflegekassen und Hilfeplangesprächen.
Denn am Ende bringt es wenig, wenn alle wissen, was Autismus bedeutet, aber niemand mehr da ist, der Autistinnen und Autisten begleitet.
Und trotzdem: Aufklärung ist natürlich wichtig
Bei all dem, was ich beschrieben habe, den Lücken, dem Personalmangel, der Überforderung, der Ungleichheit, könnte man leicht den Mut verlieren. Und ja, ich habe Momente, in denen ich mich frage, wie das alles noch weitergehen soll.
Aber dann schaue ich meinen Sohn an. Und ich sehe, wie viel Lebensqualität mit den richtigen Menschen an seiner Seite möglich ist. Ich sehe Eltern, die unermüdlich kämpfen, und Fachkräfte, die trotz allem bleiben. Ich sehe Mitarbeitende, die mit vollem Herzen dabei sind und entdecke Ideen, die entstehen, weil Not erfinderisch macht.
Das gibt mir Kraft. Und deshalb mache ich weiter.
Ich kläre auf, ich schreibe, ich begleite, ich frage nach. Nicht, weil ich denke, dass ich die Lösung für alles habe, sondern weil ich glaube, dass jede Stimme zählt und weil jede und jeder da draußen wissen soll, dass man mit diesem Thema nicht alleine ist. Und weil ich weiß, dass Aufklärung dann wirksam wird, wenn sie verbunden ist mit echter Erfahrung, mit Empathie und mit dem Willen, gemeinsam etwas zu verändern.
Was du tun kannst:
Wir können in der Regel keine Gesetze verändern oder neue Fachkräfte und Mitarbeitende aus dem Hut zaubern. Aber es gibt trotzdem Möglichkeiten, im Kleinen oder gemeinsam mit anderen etwas zu bewegen.
Hier sind ein paar Impulse, was du konkret tun kannst – egal ob du als Elternteil, Fachkraft oder engagierter Mensch mitliest:
✅ 1. Raum für kreative Lösungen schaffen
Wenn die vorgegebenen Strukturen nicht greifen, lohnt es sich, neue Wege zu denken: Assistenzmodelle, Kooperationen, Peer-Ansätze, Tandemlösungen, kleine Netzwerke vor Ort…
Nicht jede Lösung passt ins gängige Procedere und zu jedem Menschen – aber vielleicht in deinen Alltag und es ist unbedingt an der Zeit, dass wir neu denken und kreativ werden.
Dafür kannst du zum Beispiel auch das Persönliche Budget nutzen. Informiere dich HIER darüber.
✅ 2. Kompromisse als Zwischenschritte sehen
Auch wenn der Idealzustand gerade nicht erreichbar ist: Manchmal sind unperfekte Lösungen besser als Stillstand. Eine halbe Begleitung ist besser als keine. Ein Wochenplan mit Pufferzeiten besser als ständiger Stress. Und Kompromisse müssen nicht das Ende der Fahnenstange sein – sie können Teil eines definierten Stufenplans werden, der dich Schritt für Schritt deinem eigentlichen Ziel näherbringt.
✅ 3. Wertschätzung zeigen – gerade jetzt
Ein ehrlich gemeintes „Danke“ kann viel bewirken. Für Fachkräfte, die bleiben, obwohl es schwer ist. Für Eltern, die durchhalten. Für Menschen, die zuhören, mitdenken, mitgehen.
Sichtbare Wertschätzung macht gerade in einer Zeit, in der viele am Limit sind, einen großen Unterschied.
✅ 4. Austausch suchen – online oder vor Ort
Du musst das alles nicht allein tragen. Ob im Kollegenkreis, im Elternnetzwerk, in einer Onlinegruppe oder in deinem Sozialraum: Austausch stärkt, tröstet, inspiriert. Und manchmal entsteht daraus etwas, womit niemand gerechnet hat.
Von Ellas Blog findest du dazu HIER ein Angebot für Eltern.
✅ 5. Beitrag weitergeben
Wenn dich dieser Beitrag anspricht, dann teile ihn. Druck ihn aus und gib ihn weiter, z. B. an Kolleg:innen, in Teamsitzungen, an Entscheidungsträger, bei Hilfeplangesprächen oder einfach im Gespräch mit anderen.
Oder teile den Link, um andere zu sensibilisieren. Jede geteilte Erfahrung kann ein neuer Impuls sein.
Danke, dass du mitliest. Danke, dass du dranbleibst.
Wir brauchen genau solche Menschen.
